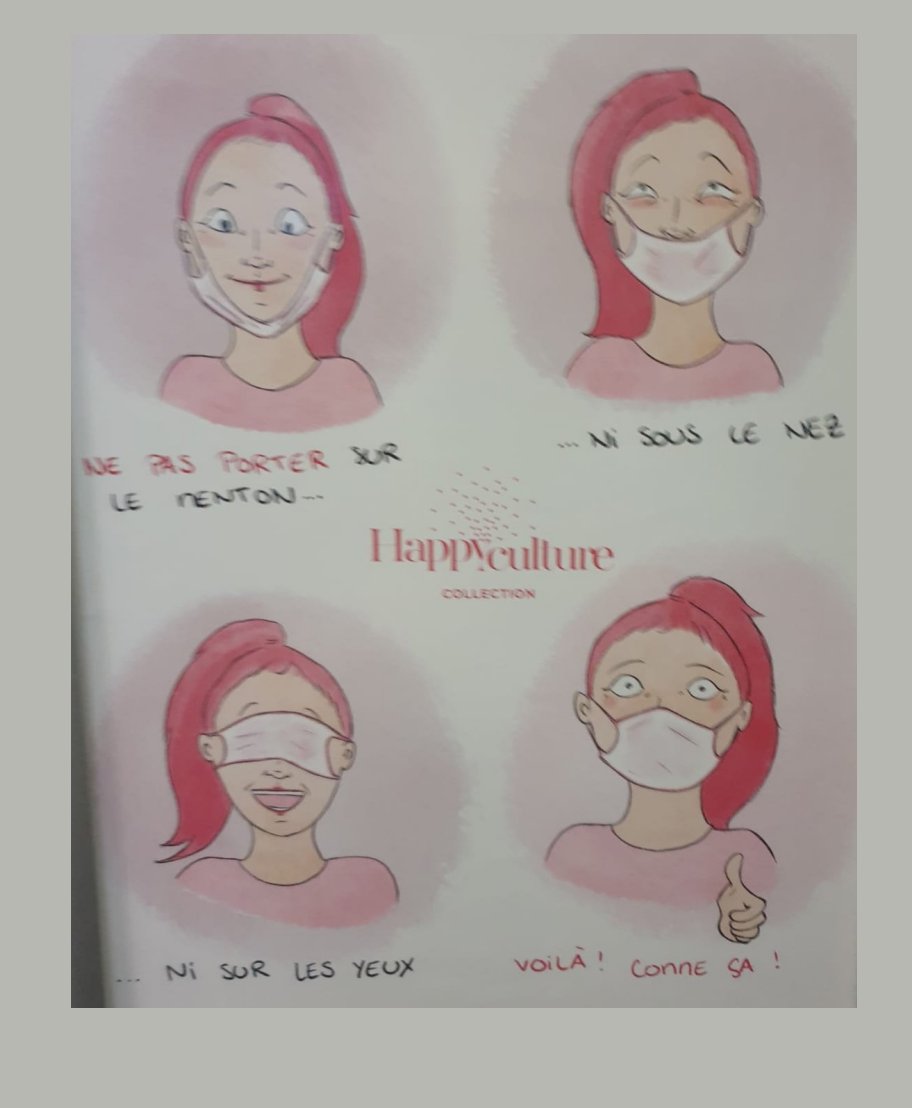Obwohl künstlerisches Mittelmaß herrscht, ist die Vorstellung ausverkauft.
Anderenorts ergreift die Produktion mit Haut und Haaren, das Haus aber ist kaum zur Hälfte gefüllt. Gewiss war das auch schon vor Covid zu erleben. Vor allem dann, wenn es sich im einen Fall um einen Repertoireschlager handelte, im anderen um eine Rarität oder gar ein zeitgenössisches Werk. Doch unabhängig vom künstlerischen Rang der jeweiligen Produktion sind inzwischen extreme Ausschläge des Publikumszuspruchs nach unten selbst bei Musik- und Sprechtheaterwerken zu verzeichnen, die bislang als Vorverkaufsmagneten galten.
Keine Frage, nun tritt zutage, wie arg einige Häuser am Publikum vorbei produzieren.
Aber die Theater unter Generalverdacht zu stellen, führt geradewegs in die Sackgasse. Erhebt sich dann in seinem Gefolge die Forderung nach sogenannter „Werktreue“, wird offenbar, woher der Wind weht und welche Untoten sich da ein Stelldichein geben möchten. Musealisierung soll das Publikum zurückgewinnen. Endlich wieder Illusionstheater, Aida mit Pyramiden und Faust im hohen gotischen Gewölbe. Alte Ägypter und sonstige pittoreske Epochen freilich können die Kino-Traumfabriken besser. Doch sei dem wie ihm wolle, für die Bühne existiert als Hauptgesetz die Verpflichtung zu packendem Theater. Zahlreiche Häuser lösen sie ein, mögen immer ihre Ensembles vor halbleerem Saal spielen.
Menschen unterliegen der Macht der Gewohnheit, sie folgen dem Trägheitsgesetz.
Wer, um der Pandemie zu entrinnen, zwei Jahre nicht in der Kirche, auf der Parteiversammlung oder beim Vereinsabend war, hält meist Kirche, Partei und Verein nach wie vor für wichtig, vermisst sie bisweilen gar. Andererseits bestehen die Institutionen fort, ohne dass man hingehen muss. Beruhigend und – zumal bei Leuten in gesetzteren Jahren – nachvollziehbar. Nur in Ausnahmefällen fände bei ihnen die Forderung nach Kürzungen öffentlicher Mittel für das Theater vor Ort Zustimmung, im Gegenteil stieße sie, schon weil das Gewissen sich regt, auf Widerspruch.
Ob der drastische Publikumsschwund in einigen Theatern unabhängig von künstlerischen Leistungen auf eine Kettenreaktion zurückzuführen ist, müsste untersucht werden.
Über direkte oder aber mittelbare Kontakte sind Theaterbesucherinnen und Theaterbesucher mit einiger Wahrscheinlichkeit dichter vernetzt, als sie selbst ahnen. Bewusst oder unbewusst orientieren sie sich aneinander. Wenn Sitznachbarn fehlen, neben denen man womöglich seit Jahrzehnten Platz nimmt, fällt das eigene Fernbleiben desto leichter. Diesen Teil des einstigen Publikums zurück zu gewinnen wird nicht vollständig gelingen. Denkbar, dass der Prozentsatz weit hinter den Erwartungen zurückbleibt.
Bei den Jüngeren und Mittleren – jenen, die am Beginn ihrer beruflichen Laufbahn oder mitten darin stehen – ist freilich vieles machbar.
Doch erst, wenn die Bildungsbiografien dieser Alterskohorten in die Überlegungen der Häuser miteinbezogen werden. Das betrifft vor allem den Verlust des Kanons. Längst sind Goethes „Iphigenie auf Tauris“ und Mozarts „Don Giovanni“ keine Werke mehr, deren Kenntnis als verbindlich vorausgesetzt wird, um Bildung zu beweisen. Kann sein, Bildung ist überhaupt ein Begriff von gestern. Jedenfalls müssen künftig vormals kanonische Opern und Schauspiele um die Gunst der Jüngeren werben. Immer von neuem. Abonnements tendieren absehbar zum Auslaufmodell. In den unsicheren und langfristig kaum planbaren Zeiten von Pandemie, Krieg und drohender Rezession ohnehin. Die Theater sollten sich darauf einstellen. Paradoxer Weise sind dennoch die Kartenpreise zweitrangig, die Mutation zum billigen Jakob wäre fatal. Und im Übrigen, weil die Zuweisungen öffentlicher Mittel an die Bühnen wohl kaum steigen werden, nicht durchzuhalten.
Fortan gilt es, die Jüngeren und Mittelalten dort abzuholen, wo sie stehen.
Keinesfalls, um sich ihnen anzubequemen, nicht also der Affirmation halber, doch um ihnen, sobald der Vorhang sich hebt, unbekannte Perspektiven und gar Welten aufzuschließen, sie ihnen – im wahrsten Wortsinn – vorzustellen. Einiges von dem, was sich noch immer Avantgarde wähnt, ist für diese Altersgruppe welk. Abgehalftert. Es braucht das frische Narrativ, die vitale Erzählung.
Wenn trotz Produktionen, die den Anspruch einlösen, dennoch die Jüngeren und Mittelalten ausbleiben, empfiehlt sich dem jeweiligen Haus zu realisieren, dass Theater nicht allein bedeutet, Vorstellungen auf die Bühne zu hieven.
Bedacht sein will dessen Selbstdarstellung vom Auftritt im Netz über den Eindruck, den die Mitarbeitenden – einschließlich der Leitung des Hauses – hinterlassen bis zu den Unbilden des Pausencaterings. Zumutungen sind der Bühne vorbehalten. Im Servicebereich haben sie nichts zu suchen. Wer solche das Umfeld der Vorstellung betreffenden Überlegungen für nebensächlich hält, steht bald schon auf verlorenem Posten.
Kommentare geben die persönliche Sicht der Verfasserin / des Verfassers wieder.
Sie entsprechen nicht in jedem Fall der Auffassung von LIMELIGHT.